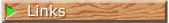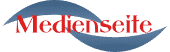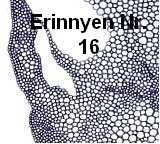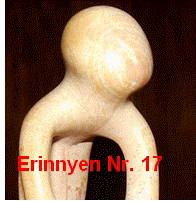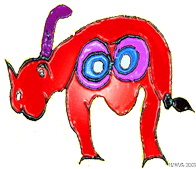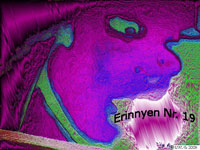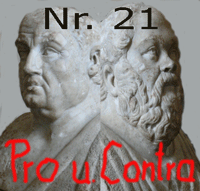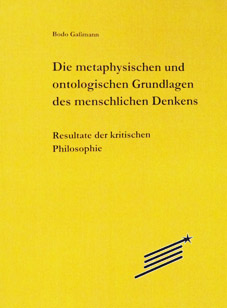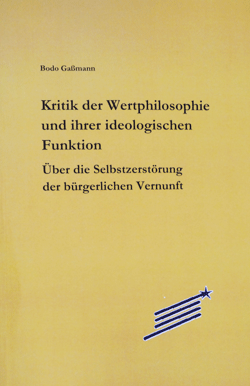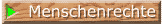

 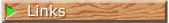



|
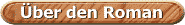
(Ein Essay von Bodo Gaßmann: Versuch einer Apologie des Romans
am Beispiel von Arno Kaisers „Fieber“
und anderer Romane)
Sozialistischer Realismus
Die Geschichte hört nicht mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft auf, wie Hegel meinte, sondern verlangt nach deren Abschaffung, wie die Romane von Balzac (sowie der anderer großer Romanautoren) und ihre philosophische Verallgemeinerung auf einen neuen Stand des Denkens und der Philosophie bei Marx und Engels zeigen.
Gegenüber dem sich verselbstständigenden Mechanismus der bürgerlichen Welt wird der bürgerliche Roman immer negativer und schlägt letztlich um in einen sozialistischen Realismus, dessen einziges gemeinsames Merkmal die Tendenz ist, die bürgerliche Welt und damit jede Art von Herrschaft über Menschen zu transzendieren. Dieser negative Blick auf das Bestehende ist z. B. im „Untertan“ von Heinrich Mann oder im „Alexanderplatz“ von Döblin stark ausgeprägt, ohne die bürgerliche Welt zu transzendieren. Diese Grenze durchbricht erst Gorki mit seinem Roman „Die Mutter“, ohne bereits das formale Niveau großer bürgerlicher Romane zu erreichen.
Der letzte Satz verweist auf die adäquate Form, die ein Roman mit einer sozialistischen Tendenz haben sollte. Die inhaltliche Tendenz in diese Richtung reicht nicht aus, wenn die Form dem Inhalt adäquat sein soll. Inhaltlich verweist der Roman von Arno Kaiser auf die Transzendenz des Bestehenden sowohl des Herrschaftssystems der DDR wie des im Westen. Dies wird vor allem in zentralen Passagen wie der Erfahrung des Prager Frühlings durch das erlebende Ich deutlich. Wie kann der Protagonist, der von Gruppe zu Gruppe der Diskutanten in Prag geht, nicht auch auf den Inhalt der Gespräche eingehen? Insofern ist Reflexion, sind theoretische Gedanken Teil der Handlung, die einen humanen Sozialismus antizipieren.
Wenn ein Roman, der an Realismus in irgendeiner Form gebunden ist, eine Tendenz in ein Nocht-Nicht darstellen will, dann kann er dies ex negativo bewerkstelligen. Die zwei satirischen Passagen im Roman „Fieber“ könnte man hierzu rechnen. Das erlebende Ich lernt kurz in einem Café in Bratislava eine ältere Dame kennen, die reaktionäre Ansichten äußert. Gegen deren Goldringe und gegen deren Pinscher mobilisiert der Warschauer Pakt Panzer, Soldaten und die Staatssicherheit. Kaiser stellt das dar, um das Groteske der später anrollenden Invasion deutlich zu machen. Dagegen im Westen: Das erlebende Ich will Demokratie lernen und erfährt die bierdunstige Wahl von Kandidaten, die alle kommerzielle Interessen vertreten, dies aber mit sozialistischen Phrasen durchsetzen wollen, um die Stimmen der Jusos zu gewinnen, die sie benötigen. Doch ex negativo auf das Bessere zu verweisen, reicht nicht aus. Genauso könnte man aus diesen Passagen schließen, die Welt ist schlecht und bleibt schlecht. Diese Negativität oder abstrakte Negation macht noch keinen Unterschied zu Beckett oder Heinrich Mann aus. Bei Kaiser dagegen wird ein Ausweg aus der Negativität angedeutet: Die Reflexion des erzählenden Ichs, dass der Protagonist, sein junges Ich, trotz der negativen Erfahrung mit der Stasi in der DDR Sozialist geblieben ist, auch im Westen das einmal als vernünftig Erkannte sich bewahrend, ist solch ein Hinweis. Vor allem aber, dass der Protagonist im Westen nach seinem Studium und Referendariat nicht in den Staatsdienst geht, den Marsch durch die Institutionen antritt, in dem die meisten versinken, sondern in einen linken Buchladen mit politischem Anspruch eintritt, verweist inhaltlich auf diese das Bestehende transzendierende Tendenz.
Aber sozialistischer Realismus, undogmatisch verstanden, muss sich auch in den literarischen Formen offenbaren. Dabei gilt eine Einsicht von Brecht: „Alles Formale, was uns hindert, der sozialen Kausalität auf den Grund zu kommen, muß weg; alles Formale, was uns verhilft, der sozialen Kausalität auf den Grund zu kommen, muß her.“ (Zitiert nach: Brüggemann: Literarische Technik, S. 267)
Zurück zum Anfang der Seite
Weiter zu:
Die Erzähperspektive am Beispiel der Kriegsromane (4)
|

Volltextsuche in:
Erinnyen Aktuell
Weblog
Hauptseite (zserinnyen)
Erinnyen Nr. 16
Aktuelle Nachrichten
der Argentur ddp:

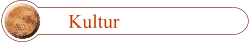
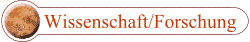

Wenn Sie beim Surfen Musikt hören wollen:

Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Audios, Fotos und Videos:
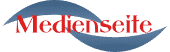
Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:

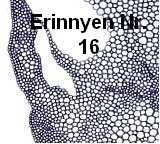
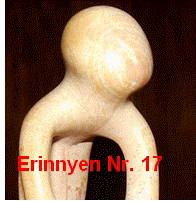
Erinnyen Nr. 18
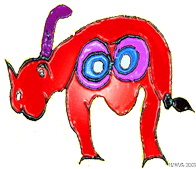
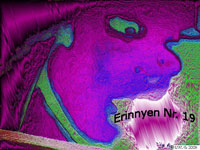

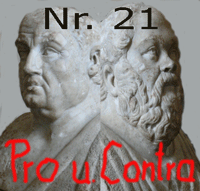
Erinnyen Nr. 22

Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:



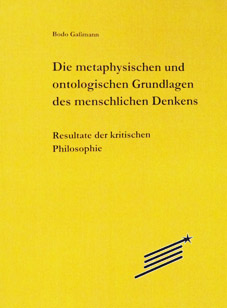
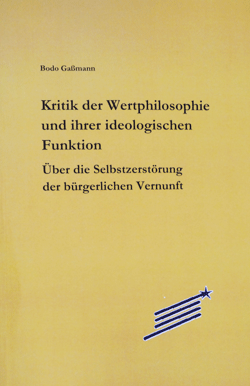
|