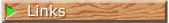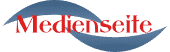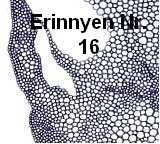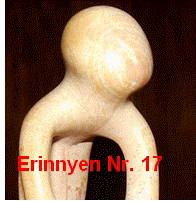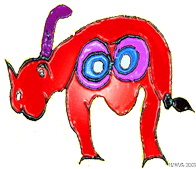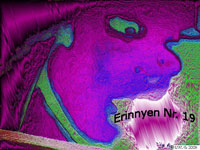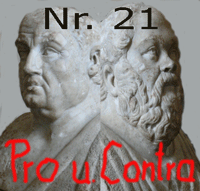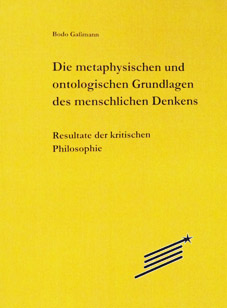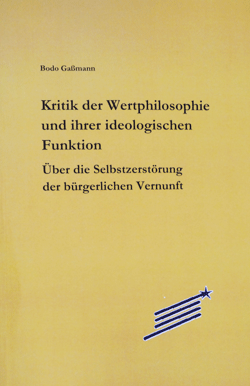|
||
|
Inhalt Über den Roman "Fieber" von Arno Kaiser Siehe dazu auch den Essay: Über den Roman
Zur Kritik Zur Kritik der Wertphilosophie und ihrer ideologischen Funktion. Über die Selbstzerstörung der bürgerlichen Vernunft.
Leseerfahrungen Über das Buch:
Eine Polemik und die Anmerkung dazu Welche Anmaßung! Eine Anmerkung zur Rezension:
Aristoteles Kategorienlehre Bodo Gaßmann über Franz Brentano und
Leseerfahrungen Über das Buch: Wer eine Zusammenfassung des Inhalts haben möchte, dem empfehle ich den Abstrakt des Autors zu lesen: (http://www.erinnyen.de/aktuelles/aktuell10.html) Ich möchte hier meine subjektive Leseerfahrung wiedergeben. Zwar habe ich einige Philosophie-Kurse am Gymnasium und an der Universität besucht, sonst bin ich aber nur ein philosophischer Laie. Zunächst hat mich beeindruckt, dass am Anfang eine kleine Einführung in die Philosophie unter dem Titel „Wir brauchen Prinzipien!“ gegeben wird, denn ohne Prinzipien bestimmen andere oder die Verhältnisse über uns – das leuchtet unmittelbar ein. Der Autor gibt mit dieser Reflexion und dem Bestehen auf allgemeingültigen Urteilen den Maßstab an, an dem er die Wertphilosophie misst. Bei Lotze habe ich mich ein wenig schwer getan, seine „induktive Metaphysik“ zu verstehen, aber sofort einleuchtend war die Erkenntnis über das Sinken des philosophischen Niveaus nach Hegel. Gaßmann stellt stichwortartig am Ende dieses Kapitels Kants philosophisches Konzept dem Lotzes gegenüber. Aus Prinzipiendenken bei Kant wird bei Lotze „Weltanschauung“, obwohl die Welt als Ganze nicht anschaubar ist. Selbst Lenin hat diesen Begriff in sein Denken aufgenommen. Vor allem aber die Begründung der Moral wird bei Lotze irrationalisiert. Aus der Vernunft als oberstes Gesetzesvermögen bei Kant werden die moralischen Werte, als deren Erfinder Lotze gilt, aus dem Gemüt, dem Gewissen und dem Gefühl legitimiert. Auch die Theologisierung des Denkens, der Eklektizismus und das auf Erzählung heruntergekommene Philosophieren zeigen den Weg zum Irrationalismus auf. Dass die Gründe für den Verfall des Niveaus nicht in der immanenten Entwicklung der Philosophie selbst liegen, macht Gaßmann durch eine soziologische Erklärung deutlich. Nach Hegel schießen eine Vielzahl philosophischer Systeme aus dem Boden, die sich nicht mehr auf Stimmigkeit überprüfen lassen, weil sie sich gegenseitig nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Welche dieser Positionen sich profilieren können, hängt dann von der vorherrschenden Politik ab, die sich die heraussucht und durch Publikationen und Lehrstühle fördert, die am besten ihre ideologischen Bedürfnisse befriedigt. In vorauseilender Spekulation richten sich die „Philosophen“ in ihrer „Denkarbeit“ nach diesen ideologischen Bedürfnissen. Bei Lotze wird die Befriedigung der Bedürfnisse der Zeit, d. h. des Bürgertums, sogar zum Prinzip erhoben. Das erklärt, warum im Kaiserreich – trotz Wissenschaftsfreiheit – nur bürgerliche Denker Lehrstühle besetzen konnten. Überhaupt scheint mir der Zusammenhang zwischen Philosophie und Ideologieproduktion bei den Wertphilosophen in Gaßmanns Schrift gelungen dargestellt zu sein: Er unterstellt nicht primitiv, die Philosophien seien von vornherein Ideologie, sondern kritisiert sie zunächst philosophie-immanent, um dann zu zeigen, welche falschen Theoreme sich besonders gut ideologisch vereinnahmen lassen. Beim Neukantianismus (Windelband/Rickert) ist mir die Begründung der „Werte“ aufgrund des moralischen Empfindens der bürgerlichen Denker aufgefallen. Der „Edelspießer“, wie Gaßmann einen Begriff aus der Literaturkritik der 60er Jahre aktualisiert, wird zum Maßstab für die Werte, die zählen sollen. Das hat zur Folge, dass auch Menschen eingeteilt werden in wertvolle (Goethe) und weniger wertvolle (z. B. Wilde in Afrika) – der deutsche Imperialismus und der Völkermord in Deutschsüdwest konnte sich hier seine Legitimation holen. Der Tiefpunkt dieser „Rolltreppe abwärts“ zum Irrationalismus ist dann die materiale Wertethik Schelers, deren Basis zur Begründung von moralischen Werten das „Wertfühlen“ wird. Dabei soll das Fühlen eine gleichberechtigte „Grammatik“ haben wie das diskursive Denken. Dass Gefühle und das „Fühlen“ immer auch ambivalent sind, wie schon Platon wusste, von der Sozialisation abhängen, wie Gaßmann mit Horkheimer nachweist, wird von Scheler nicht beachtet. Scheler war kein Nazi, seine Bücher durften in der NS-Zeit nicht erscheinen. Auch Theodor Lessing, ein Kritiker des rationalen Denkens, war Gegner des Faschismus. Ihre Thesen kranken daran, dass sie die „Grammatik der Gefühle“ und Lessings Mystik selbst nur in diskursiver, also rationaler Rede vortragen konnten. Dennoch haben ihre irrationalistischen Auffassungen den deutschen Faschismus befördert, indem sie das geistige Leben des Bürgertums zusammen mit anderen irrationalisierten und ihm so die geistigen Waffen gegen den Faschismus aus der Hand nahmen. Das heißt bei Gaßmann die „Selbstzerstörung der bürgerlichen Vernunft“. Hitler konnte sich auf das geistige Klima des Irrationalismus verlassen und selbst von Werten schwafeln. Diese Einsicht hat mich endgültig dazu bewogen, den Begriff des moralischen Wertes aus meinem aktiven Wortschatz zu streichen. Dass der Begriff des moralischen oder sittlichen Werts so populär wurde, verdankt sich aber nicht den sterilen Systemen der Fachphilosophen wie etwa auch der Ontologie von Nicolai Hartmann, sondern der Wirkung von Nietzsches Philosophie vor allem nach seinem Tod bis heute. Gaßmann hat den bereits in seinen „Erinnyen“ veröffentlichten Aufsätzen zur Kritik der Wertphilosophie in seinem Buch einige Kapitel hinzugefügt, so über Nietzsche, Max Weber, Nicolai Hartmann und Habermas. In zwei Abschnitten über Max Weber hat mich der Zusammenhang mit der Werttheorie des Neukantianismus fasziniert. Wer sonst nichts über Max Weber weiß, kennt seine Forderung nach Wertfreiheit in der Wissenschaft. Gaßmann zeigt nun, auf den Reflexionen seines akademischen Lehrers Peter Bulthaup fußend, dass diese Forderung bei Weber widersprüchlich ist. Denn um das soziologische Material in einer verständlichen Darstellung zu organisieren, benötigt Weber Werte, wie er sie im Neukantianismus vorfindet. Zugleich ist ihm aber bewusst, dass solche Werte nicht stringent sich begründen lassen – im Gegensatz zur Auffassung der Neukantianer Windelband und Rickert. Dieser widersprüchliche Werteidealismus wirft dann auch ein neues Licht auf seine Studie über den „Geist des Kapitalismus“, als habe der Geist den Kapitalismus geschaffen, die direkt gegen Marx, der wechselseitiges Entstehen von kapitalistischen Verhältnissen und den entsprechenden Geist annahm, konstruiert ist. Das Kapitel über Nicolai Hartmann hat mich enttäuscht, weil dieser nur Schelers Thesen nochmals ontologisch absichert. Auch wiederholt Gaßmann noch einmal mit Kant seine Ontologiekritik. Dagegen ging mir in dem abschließenden Habermas-Kapitel ein Licht auf. Diesen Autor hatte ich bisher wahrgenommen als linken Philosophen, der die Kritische Theorie weiterführe, wenn auch mit einer z. T. idealistischen Diskurstheorie („ideale Gesprächssituation“). Gaßmann zeigt nun, wieviel Habermas von seinen einstigen Gegnern, den Positivisten, übernommen hat. Da ist der Linguistik Turn, der Philosophie durch Sprachreflexion ersetzen will, seine kontrafaktische Abkehr von der „Bewusstseinsphilosophie“ und dem „Monologisieren“, obwohl Habermas nichts anderes in seinen Büchern macht als zu monologisieren. Was aber dann herauskommt, ist bloß ein formalistisches Glasperlenspiel. Habermas zeigt nicht, wie man „sittliche Werte“ mit der Diskursethik begründen kann, sondern lediglich, welche Diskursregeln eventuell zu einem Konsens über moralische Prinzipien führen können, während Werte von vornherein dem Pluralismus der kapitalistischen Gesellschaft überlassen bleiben. Gaßmann kritisiert mit Kant den „Konsens“ in wissenschaftlichen Fragen bzw. in denen der Moral, indem er auf die Objektivität verweist, der allererst ein Konsens folgen, nicht aus dem Konsens die Objektivität begründet werden kann. Letztlich erweist sich die habermassche Philosophie als eine weitere Form des vorherrschenden Skeptizismus, der im Pragmatismus, von dem Habermas viel übernommen hat, in der Abschaffung des Begriffs der „Wahrheit“ kulminiert. Dies wird allerdings nur dem deutlich, der sich nicht nur für die anwendbaren Resultate seiner Philosophie interessiert, sondern mit Gaßmann auch auf die Begründungsweisen und den Bezug zum Ontologischen reflektiert. Man kann das Werk von Gaßmann auch als eine Phänomenologie der bürgerlichen Philosophie lesen, die einem viel Mühe erspart, alle diese Wälzer zu lesen, sodass man sich auf die klassischen Werke der Philosophiegeschichte konzentrieren kann. Alles in allem zeigt dieses Buch für mich, wozu die Philosophie missbrauchbar ist, aber auch ex negativo, was wahre Philosophie sein könnte.
|
Unser Internetbuchladen:
|
|
© Copyright: Alle Rechte liegen bei den Erinnyen. Genaueres siehe Impressum. Letzte Aktualisierung: 16.10.2014 |
||